Roter Stein
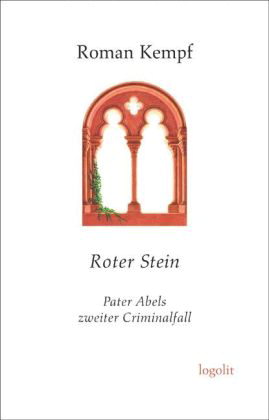 In "Roter Stein" erzählt Roman Kempf den erfolgreichen und preisgekrönten Premieren-Band "Schöner Wein" um Pater Abel fort.
In "Roter Stein" erzählt Roman Kempf den erfolgreichen und preisgekrönten Premieren-Band "Schöner Wein" um Pater Abel fort.
Abel, Cellerar einer Benediktinerabtei, verliert beim Bau des neuen Konvents seinen wichtigsten Gefährten. Der Steinmetz Jakob Dumont wurde heimtückisch ermordet. Er war ein exzellenter Bauleiter - und hatte dazu eine alte Urkunde aufgespürt, die alle finanziellen Probleme des Klosters lösen würde.
Abel ermittelt auf eigene Faust. Alle Spuren folgen dem roten Sandstein in die raue Welt von Bau, Betrug und Macht.
Die Sandsteinsäulen vom Bullauer Berg stammen von den Riesen.
Sagt der Volksmund, der alles weiß.
Ein ebenso eindrucksvolles wie rätselhaftes Zeugnis für die Fertigkeit, mit der
die Steinbrecher und Steinhauer der Zeit um – wahrscheinlich – 1000 nach
Christus Aufträge gigantischen Ausmaßes zu bewältigen wussten, wurde auf der
Gemarkung Miltenberg auf dem bewaldeten Osthang des Bullauer Bergs gefunden.
Dort stieß man auf eine Gruppe von riesigen, als ganze Stücke aus dem Fels
heraus gesprengten (monolithischen) Buntsandsteinsäulen. Sie sind gleichartig
gestaltet, bis zu 7,50 Meter hoch, jede von ihnen misst 1,10 Meter im
Durchmesser.
Ursprünglich waren es 14.
Die älteste Notiz, die sich über die Säulen vom Bullauer Berg erhalten hat, stammt aus dem
18. Jahrhundert und beziffert den bestand auf 14 Stück. Doch damals lagen sie
seit Jahrhunderten herum und gaben schon das vierfache Rätsel auf: Wann, warum,
woher, wohin?
Die Fundstelle besitzt weder einen Steinbruch, noch lässt sie Vorbereitungen für
die Errichtung eines Bauwerks erkennen, für das die Säulen hätten bestimmt sein
können, nicht einmal eine Lagerstätte. Dort oder dafür waren sie nicht
angefertigt worden. Sie müssen sich vielmehr auf einem Transport befunden haben,
der eine Unterbrechung erlitt, die unvorhergesehen und so endgültig war, dass
die Säulen abgestellt oder fluchtartig verlassen wurden und dass man sie auch
später nicht mehr weitertransportieren konnte oder es nicht wollte.
Wo die Steine gebrochen und die Säulen hergestellt worden waren, ist unbekannt.
Unbekannt sind auch Verwendungszweck, Bestimmungsort, die ursprüngliche Zahl der
Säulen und der Grund der Unterbrechung, die der Transport erlitten hat.
Einige der Säulen sind in der Zwischenzeit auf Wanderschaft gegangen.
Aufgerichtet (5,70 Meter hoch, gut 14 Tonnen schwer) steht heute eine in den
Anlagen am Miltenberger Mainufer, eine andere auf dem Mainzer Domplatz, eine
dritte und vierte wird auf dem Gelände des Nürnberger Nationalmuseums und der
Prähistorischen Staatssammlung in München gezeigt. Im Wald auf dem Bullauer Berg
sind nur noch wenige zurückgeblieben.
So einhellig die Säulen allerorts als Zeugnisse eines frühen und gleichwohl auf
höchster Stufe befindlichen Könnens alter Bauhütten bewundert werden, so
scheiden sich die Geister bei dem Versuch, ihre Existenz zu ergründen.
Das Volk, das Unerklärliches gern mit dem Wirken grauer und nebulöser
Vorzeitmächte in Verbindung bringt, spielt mit der Vorstellung, die Heunen, also
die Riesen, hätten die Säulen liegen gelassen. Daher heißen sie „Heunesäulen“.
Die ernsthafte Forschung hat lange Zeit zwischen zwei mit verschiedenen
Zeitstellungen verbundenen Erklärungen geschwankt: Die Säulen waren entweder für
einen am Rhein befindlichen römischen Tempel bestimmt und wurden zurückgelassen,
als der Transport von den Alemannen überrascht wurde, die im 3. nachchristlichen
Jahrhundert die Römer verdrängt haben.
Unterwegs nach Mainz? Die andere
Erklärung: Die Säulen befanden sich auf dem Transport nach Mainz, wo bis zum
Jahr 1009 der Dom gebaut und, da er im Jahr der Fertigstellung abbrannte,
anschließend wieder aufgebaut wurde. Sie seien überflüssig geworden, als man
sich in Mainz entschlossen habe, das Langhaus des Doms nicht von
Säulenmonolithen, sondern von gemauerten Pfeilern tragen zu lassen.
Heute neigt man dem letzten der beiden Erklärungsversuche zu und ist sich
bewusst, dass sie eine Antwort gibt, die neue Fragen aufwirft: hat man denn
wirklich den kostbaren Schatz von mindestens 14 Prachtsäulen einfach
weggeworfen, als von Mainz signalisiert wurde, dass man ihrer nicht mehr bedarf?
[nach oben]
Hauer, Brecher und Räumer.
Die Methoden der Arbeit am Fels blieben Jahrhunderte lang gleich.
Steinhauer war ein Lehrberuf mit zweijähriger Lehrzeit und entsprechendem Status
für Arbeit und Lohn. Er vererbte sich häufig, wozu die Gepflogenheit, dass schon
die schulentlassenen Buben im Alter von 14 oder 15 Jahren mit ihren Vätern in
die Steinbrüche gingen, günstige Voraussetzungen schuf. Wenn die Buben dann als
Lehrlinge anfingen, waren sie mit einem Großteil der Arbeitstechniken und
–anforderungen bereits vertraut.
Neben den Steinhauern gab es die Steinbrecher, die das Rohmaterial gewannen,
sowie die Bossierer. „Bossieren“ nannte man das rohe Zuschlagen der
Vorder(Ansichts-)seite von Steinquadern. Dann bearbeiteten die Steinmetze nach
den Vorgaben des Auftraggebers die für Bauten, Denkmäler und andere Projekte
vorgesehenen Steine.
In der Hierarchie ganz oben stand der Polier, ein älterer erfahrener Steinhauer,
der häufig im Angestelltenverhältnis stand und als Vorarbeiter und Vertreter des
Besitzers fungierte. Er überwachte die Werkstätten und verteilte auch die lange
Zeit üblich gewesene Frauen- und Kinderarbeit. Dann gab es auch noch die Räumer,
ungelernte Arbeitskräfte, die sich leicht aus dem Heer der Tagelöhner und armen
Handwerker rekrutieren ließen und die den massenhaft anfallenden Steinschutt auf
die Halden brachten.
Achtung, Lebensgefahr! Die Methoden
von Abbau und Weiterverarbeitung waren seit Jahrhunderten gleich geblieben. Die
Werkzeuge, mit denen um die Jahrhundertwende gearbeitet wurde, glichen mit nur
geringem Unterschied denen, die schon die alten Römer benutzten.
In den Maintalbrüchen war das unterhöhlen die gebräuchlichste Form des
Steinebrechens. Eine Felswand wurde 50 Meter breit, 10 bis 15 Meter tief und bis
zu 2 Meter hoch unterhöhlt. Die Höhe des dadurch entstandenen breiten Stollens nahm nach hinten zu
ab. Gestützt wurde der Stollen zunächst mit einigen Stein- und zahlreichen
Holzpfeilern, den so genannten Stempeln. Das Ziel dieser Vorkehrungen war, die
vordere und am weitesten frei in der Luft hängende Schicht der Felswand abreißen
und nach vorne „überstürzen“ zu lassen.
War der Polier der Meinung, dass der Berg „kommt“, wurden die Pfeiler
weggesprengt. Das Verhalten der abfallenden Steinmassen war unkontrollierbar und
machte die Arbeit in höchstem Maße lebensgefährlich.
Eine andere Methode, Steine vom Fels abzusprengen, war das Abspalten von
Steinblöcken. An gewünschten Bruchlinien entlang wurden kleine Keillöcher
geschlagen, dann wurden eiserne, 10 bis 20 Zentimeter lange „Zwickerli“
eingetrieben und die Spaltöffnungen mit großen Keilen und Brechstangen
erweitert.
Nachdem 1863 das Schwarzpulver beziehungsweise Dynamit erfunden worden war,
setzt sich langsam die Verwendung von Sprengladungen durch.
Feuer unterm Fels. Sofern es die
Witterung nur irgend möglich machte, wurde der Sandsteinabbau das ganze Jahr
über betrieben und die Winterpause möglichst kurz gehalten. Eine gesetzliche
Arbeitslosenversicherung gibt es erst seit 1927. Vorher blieben die
Steinarbeiter, wenn wegen Frost und Kälte nicht gearbeitet werden konnte, ohne
Einkommen. Sie versuchten also, den Verdienstausfall so niedrig wir möglich zu
halten. Wenn die Temperaturen auch nur einigermaßen erträglich waren, standen
sie immer noch im Steinruch an ihrer „Bank“. Nicht selten machten sie kleine
Holz- oder Reisigfeuer in Eimern an, die unter das Werkstück geschoben wurden.
Dann taute der Sandstein auf und konnte trotz der Kälte bearbeitet werden.
Die Zeiten allergrimmigster Witterung überbrückten die Steinhauern, indem sie
sich im Wald beschäftigten oder einen bescheidenen Hausierhandel betrieben.
[nach oben]
1905 bis 1912: Jahre des Rückgangs.
1950, 1960: Letzte kurze Blüte.
Heute wachsen die Steinbrüche zu.
Der Rückgang der Steinindustrie war so radikal und unausweichlich, weil sich auf
den verschiedensten Gebieten Entwicklungen angebahnt hatten, die sich in ihrer
Summe negativ auswirkten. Sogar Neuerungen, von denen ursprünglich Auftrieb
erwartet worden war, wirkten sich als Behinderung aus.
Im Hauptgewinnungsgebiet des Miltenberger Sandsteins, am Spessartrand auf dem
rechten Mainufer zwischen Wertheim und Miltenberg durchschnitt die von vielen
Hoffnungen begleitete neu angelegte Eisenbahnstrecke (Miltenberg –
Stadtprozelten 1906, weiter bis Wertheim 1912) den schmalen Uferstreifen, der
sich zwischen den Steinbrüchen und dem Fluss hinzieht. Die Bahn verlegte den
direkten Zugang von den Steinbrüchen zum Fluss. Die gewaltigen Schuttmassen
konnten nicht mehr abgetragen werden, herabstürzende Stein gefährdeten den
Zugverkehr, die Steinbrüche stellten den Betrieb ein.
Aus den Jahresberichten der staatlichen bayerischen Fabrik- und
Gewerbeinspektion von 1907 und 1912 geht hervor, dass es zwischen 1905 und 1907
zu einem radikalen Absturz bei den Arbeitsplatzzahlen gekommen war. Von 5200
Steinarbeitern 1905 hatten 1907 nur noch 4333 Männer Beschäftigung, fast jeder
fünfte Arbeitsplatz war weggefallen. Die Jahresarbeitslosigkeit stieg von 48
Tagen (1905) auf 78 Tage (1907) an und erreichte 1912 mit 102 Tagen, an denen
nicht gearbeitet wurde, einen Höchststand.
Zwei Drittel verwaist. Im Spätherbst
1910 glaubte die Fabrik- und Gewerbeinspektion, die „Anzeichen einer Besserung
in der seit Jahren daniederliegenden Sandsteinindustrie“ zu erkennen, die eine
„wenn auch geringe Hebung der auf zwei Drittel ihrer Normalhöhe gefallenen
Löhne“ mit sich brachte. Die mit diesem verhaltenen Optimismus verbundenen
langfristigen Erwartungen verwirklichten sich nicht. 1912 fand die Inspektion
fast zwei Drittel der ehemals florierenden Steinbrüche leer und verwaist vor.
Die restlichen vegetierten mit reduziertem Betrieb weiter. Vereinzelt wurde
Muschelkalk von entfernt gelegenen Gewinnungsstellen mit hohen Transportkosten
in heimische Sandsteinwerkstätten verfrachtet, um die ansässigen Steinhauer
einigermaßen zu beschäftigen.
Die Wirtschaftskrise der Jahre 1912/13 sowie der Beginn des Weltkriegs 1914/18
beschleunigten die Agonie der ehemals prosperierenden Sandsteinindustrie am
Main, im Spessart und im Odenwald.
Letzter Aufschwung. In den 1950er und
1960er Jahren erlebte die Branche noch einmal einen Aufschwung. Er kam
unvorhergesehen und hielt nicht lange an Beim Wiederaufbau der kriegszerstörten
Städte und ihrer Bauten (Aschaffenburger Schloss) und auch bei vielen der ersten
Bauwerke der Nachkriegsepoche (neues Rathaus in Aschaffenburg) war Buntsandstein
wieder gefragt. Diese Nachkriegskonjunktur ging jedoch mit rückläufigen
Aufträgen und auch wegen Erschöpfung der Steinbrüche nach wenigen Jahren zu
Ende.
Die Steingewinnung ist unrentabel und außerdem zu gefährlich geworden. Heute
wird in so gut wie keinem Steinbruch mehr gearbeitet. Im Inneren des Spessarts
sind die ausgebeuteten Steinbrüche zugewachsen und kaum mehr aufzufinden. Ins
Auge fallen dagegen immer noch die ehemaligen großen Brüche, die an das Maintal
grenzen. Hier haben die Hänge aufgerissene Flanken, deren Farbe an dunkel
gewordenes Blut erinnert.
Für den Arbeitsmarkt im Spessart und am Main hat die Steinindustrie praktisch
keine Bedeutung. Lediglich in Miltenberg haben sich drei Unternehmen
spezialisiert. Sie zählen zu den führenden Adressen bei der Sanierung und
Restaurierung historischer Steinbauten, vor allem solcher aus Sandstein.
[nach oben]